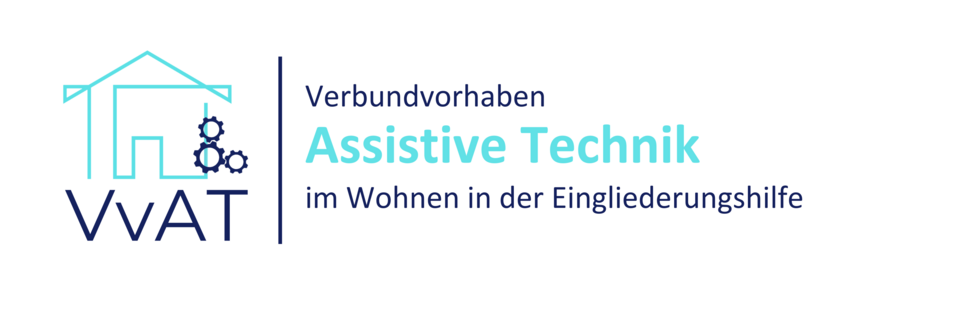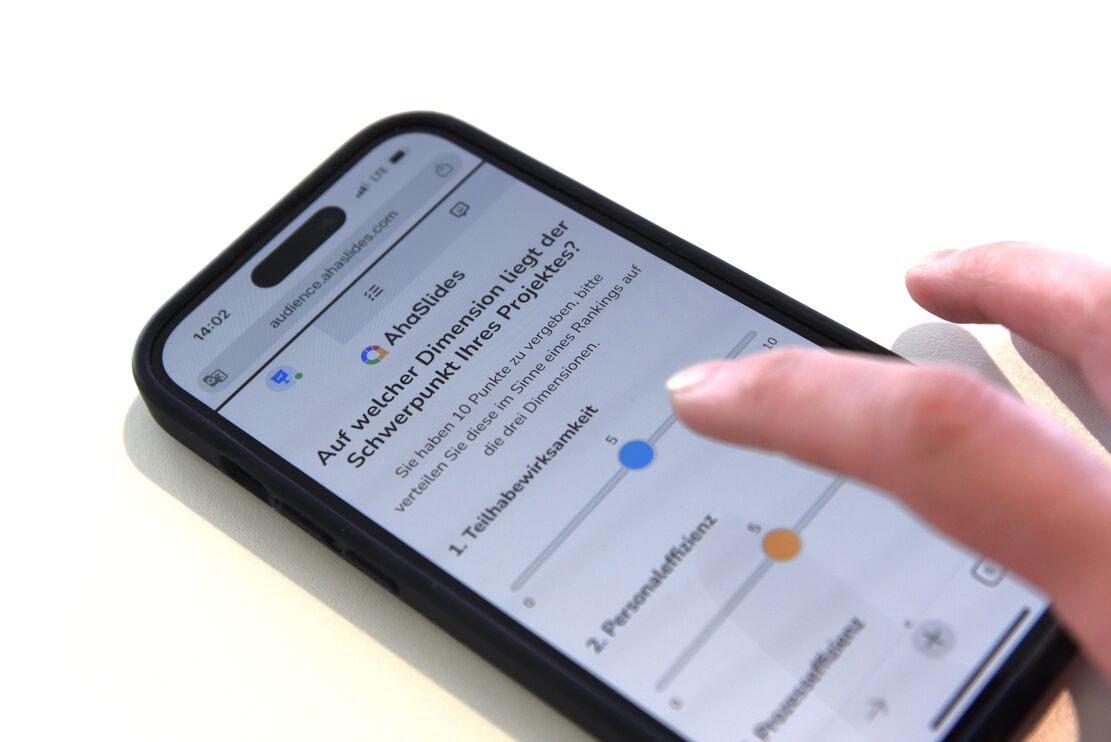Verbundvorhaben Assistive Technik im Wohnen in der Eingliederungshilfe (VvAT)
Assistive Technologien wie smarte Lautsprecher, KI-gestützte Dokumentationssysteme, mobile Sensorik oder körperunterstützende Hilfsmittel wie Exoskelette eröffnen neue Möglichkeiten, um Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag gezielt zu unterstützen. Sie bieten das Potenzial, Selbstbestimmung, Autonomie und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern – insbesondere im Kontext der Eingliederungshilfe, in dem der Alltag oft durch personelle Engpässe, standardisierte Abläufe und eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten geprägt ist. Der gezielte Einsatz digitaler Assistenzsysteme kann hier einen Beitrag leisten, um individuelle Bedürfnisse besser zu berücksichtigen, Kommunikation zu erleichtern, Belastungen im Alltag zu reduzieren und die Qualität der Unterstützung zu erhöhen.
Trotz des hohen Potenzials assistiver Technologien zur Förderung von Teilhabe und Selbstbestimmung sind sie bisher nur punktuell in der Eingliederungshilfe verankert. Häufig mangelt es an struktureller Unterstützung, erprobten Implementierungsstrategien und – zentral – an der Akzeptanz durch Fachkräfte. Studien belegen, dass technologische Innovationen nur dann wirksam eingeführt werden können, wenn Mitarbeitende deren Nutzen erkennen, in den Prozess einbezogen werden und sich ausreichend qualifiziert fühlen. Um dies zu fördern, hat das Sozialwerk NRW das Verbundvorhaben „Assistive Technik im Wohnen in der Eingliederungshilfe“ ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit zwischen zehn Einrichtungen mit Schwerpunkten in der Eingliederungshilfe, der Evangelischen Hochschule Bochum (EvH Bochum) und der Hochschule Niederrhein (HSNR) wird untersucht, wie sich Technologien sinnvoll und nachhaltig in Wohn- und Unterstützungsangebote integrieren lassen. Ziel ist es, praxistaugliche Strategien zur Einführung und Begleitung assistiver Technologien zu entwickeln – mit Blick auf Nutzer:innen, Fachkräfte und Organisationen.
Die Hochschule Niederrhein (HSNR) widmet sich im Rahmen des Projekts der Perspektive der Mitarbeitenden. Die Forschung beschäftigt sich mit der Akzeptanz und Teilhabe an assistiven Technologien. Prof. Dr. Bernhard Breil und Katharina Neuhausen verantworten dabei die qualitativen und quantitativen Forschungsschritte, die Aspekte wie technisches Wissen, Einbindung in Arbeitsprozesse, Datenschutzbedenken und die Wahrnehmung untersuchen. Ziel ist es, Gelingensbedingungen für die Einführung neuer Technologien zu identifizieren und zu fördern – unter Berücksichtigung theoretischer Ansätze der Technikakzeptanz, partizipativer Technikentwicklung und Technikfolgenabschätzung. Unterstützt wird die Implementierung von neuen assistiven Technologien durch Prof. Dr. Edwin Naroska vom Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Informatik.
Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren: 01.2025 – 12.2026