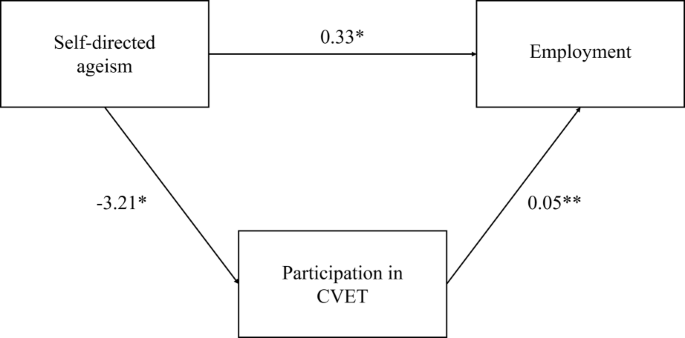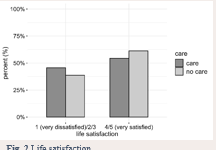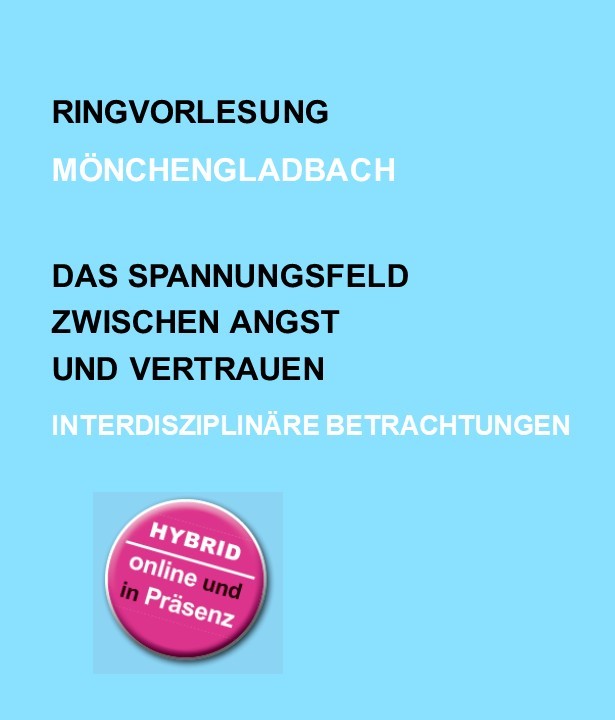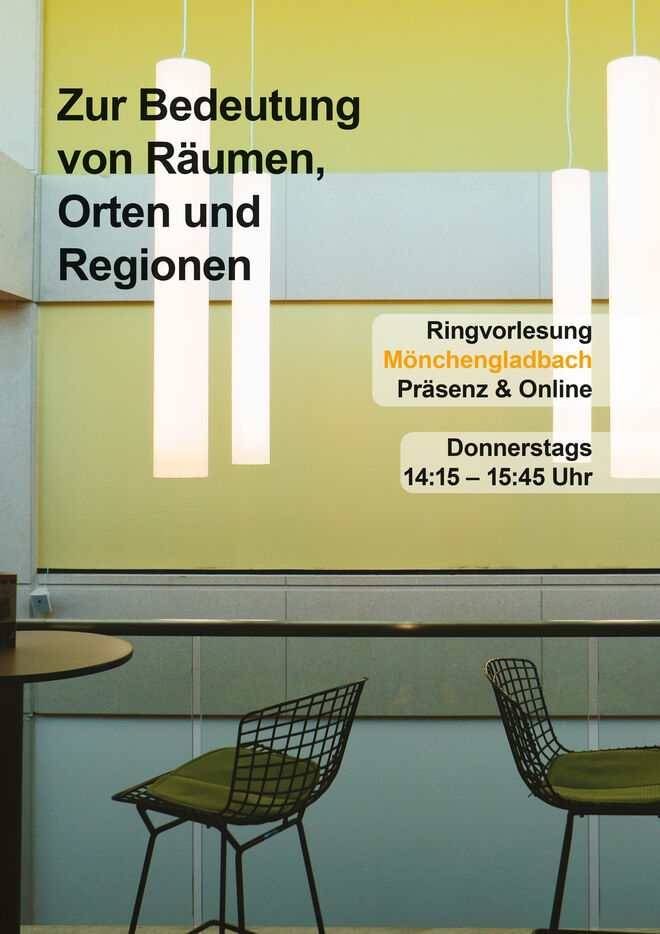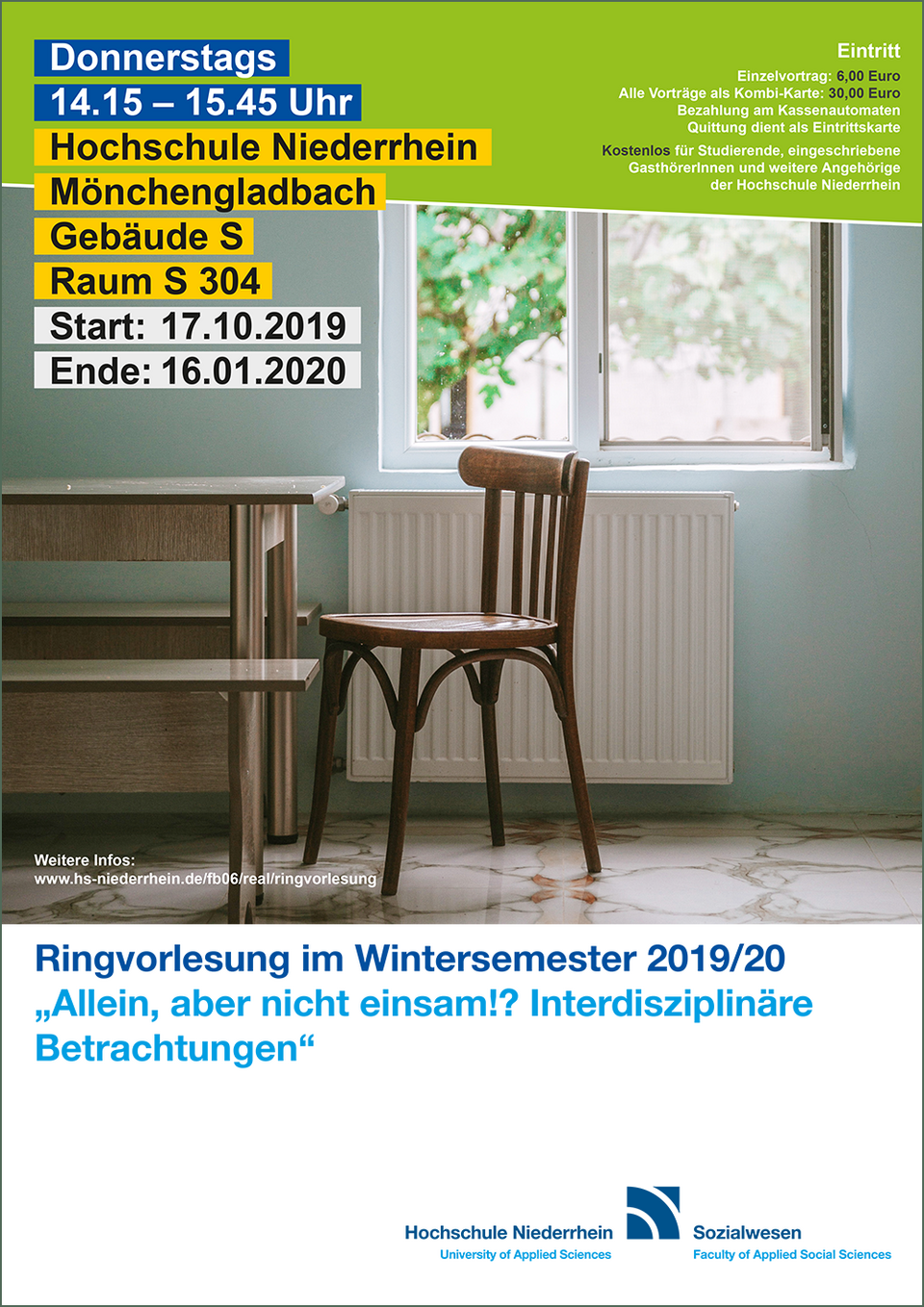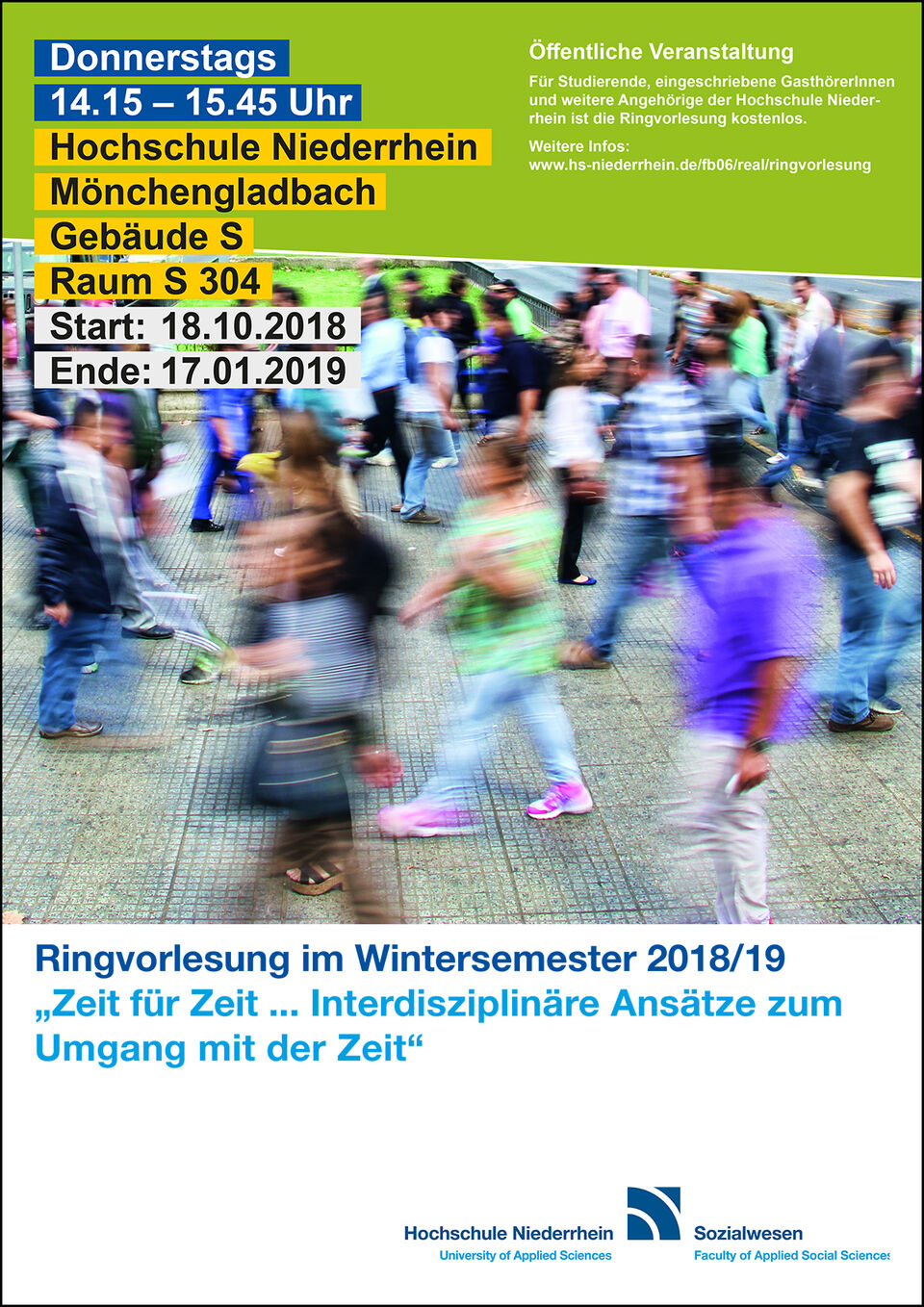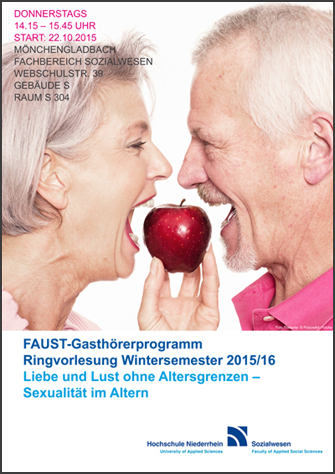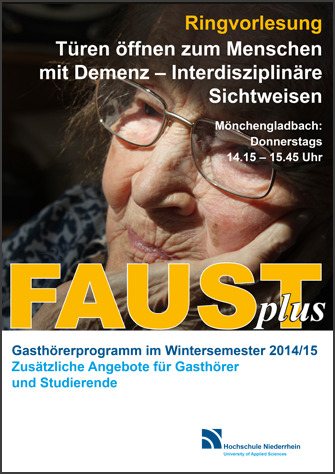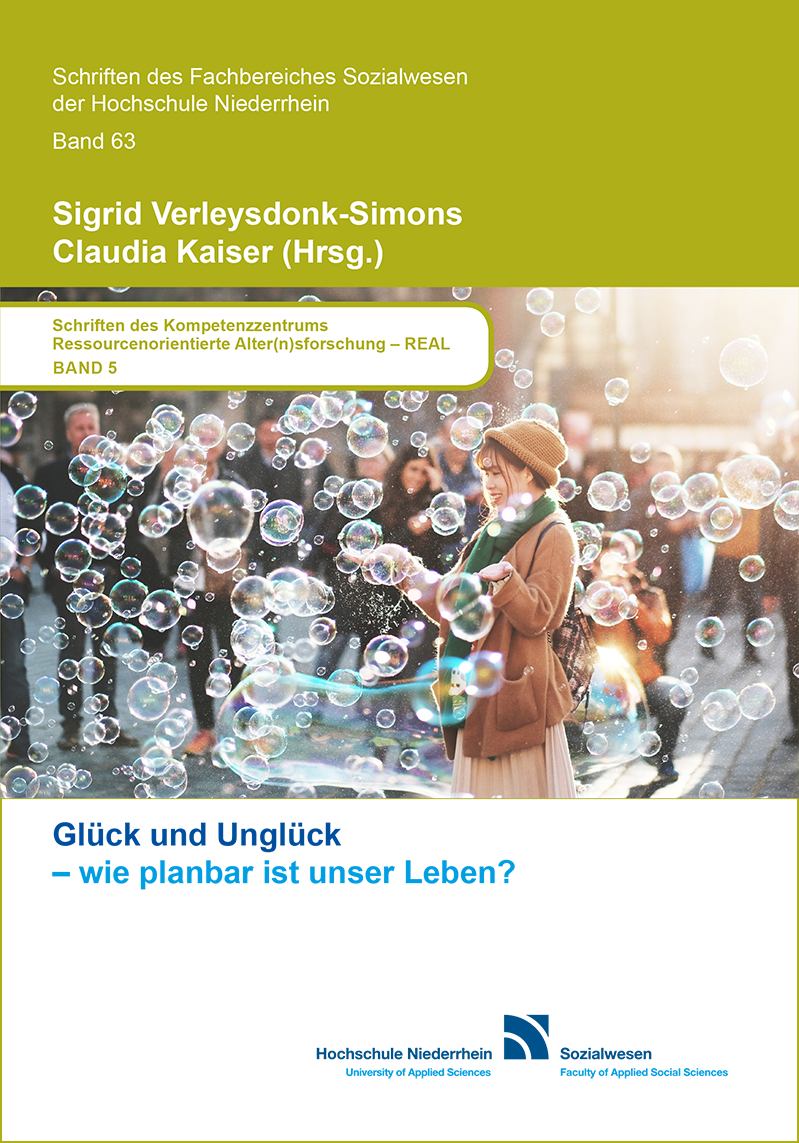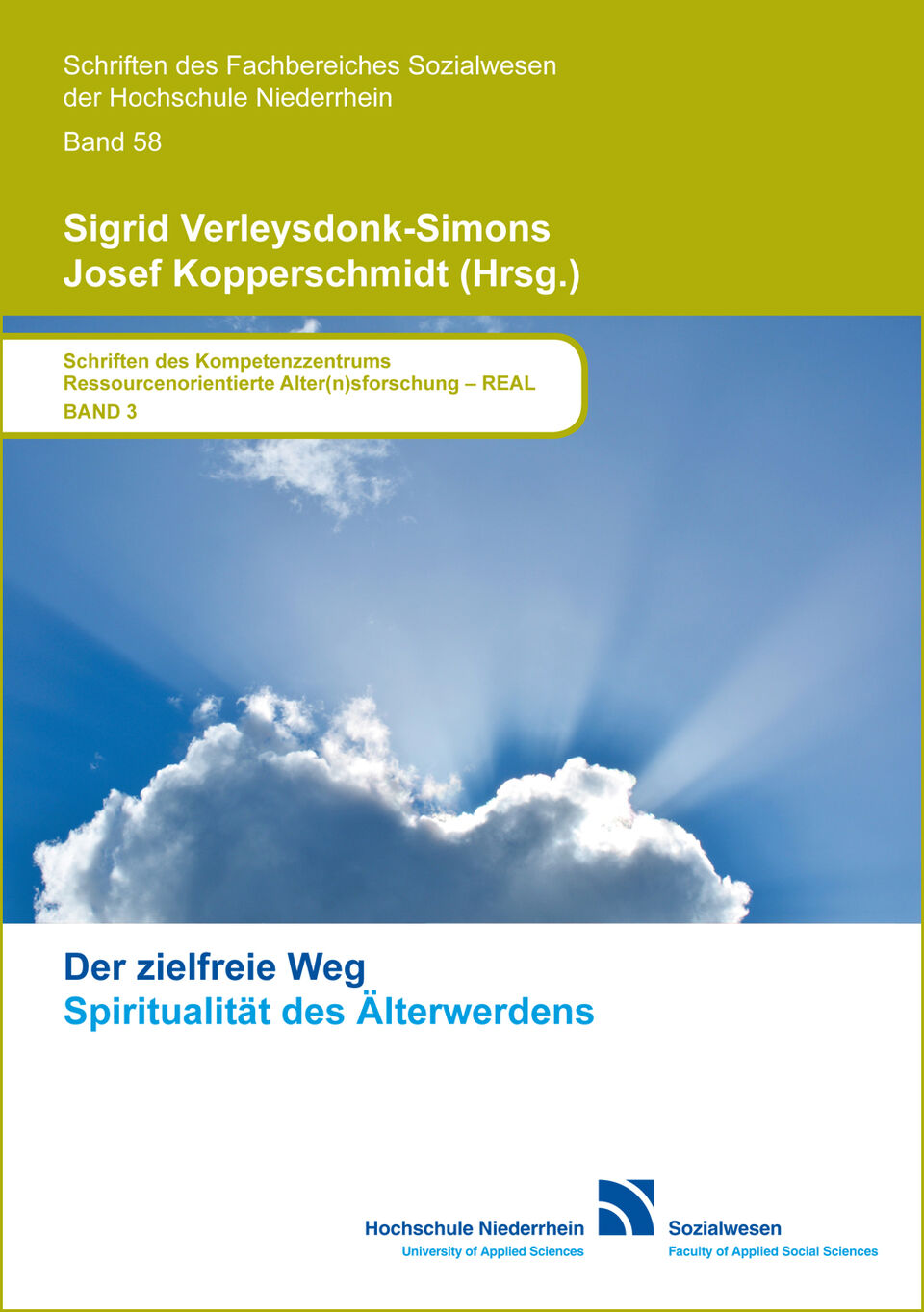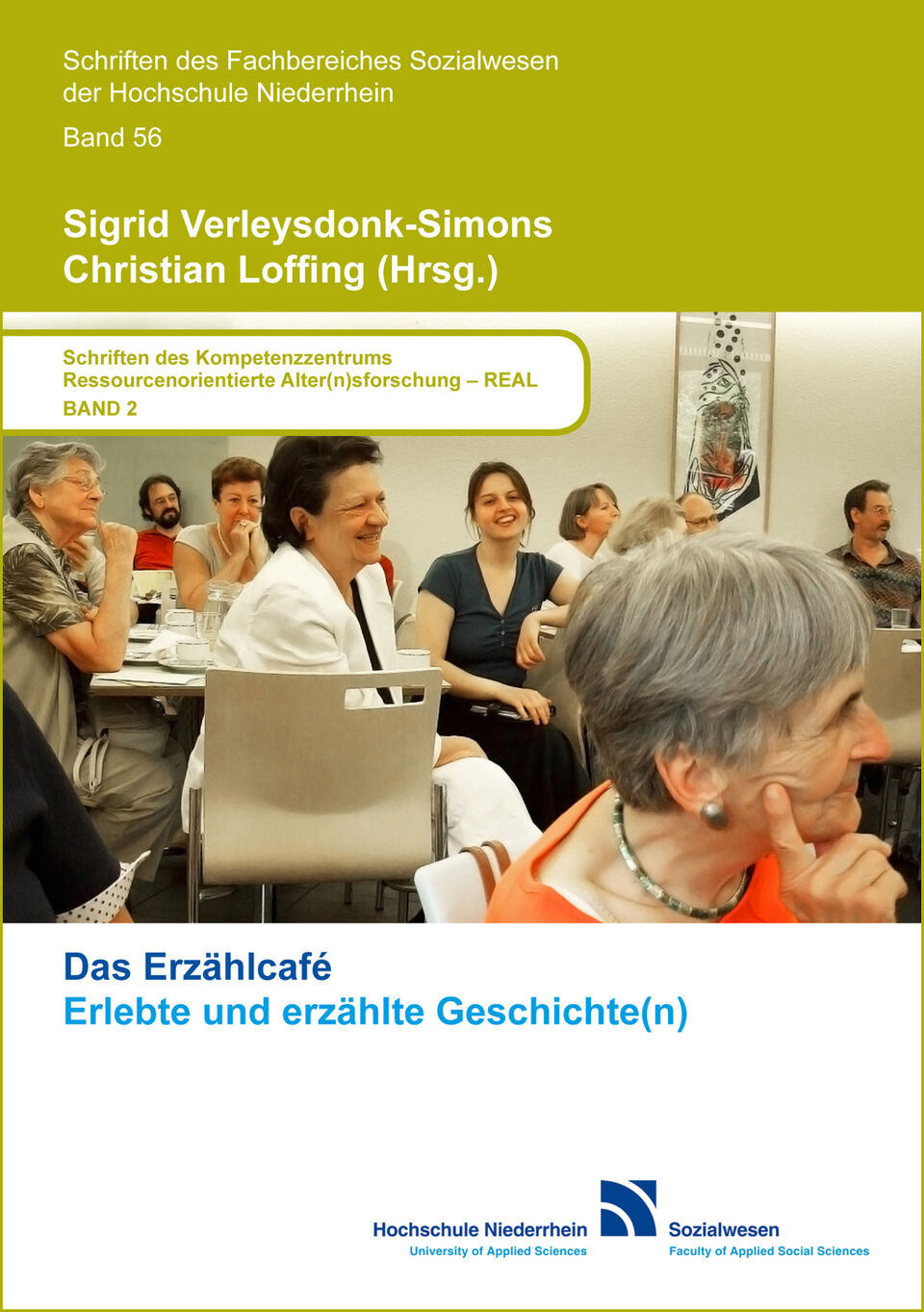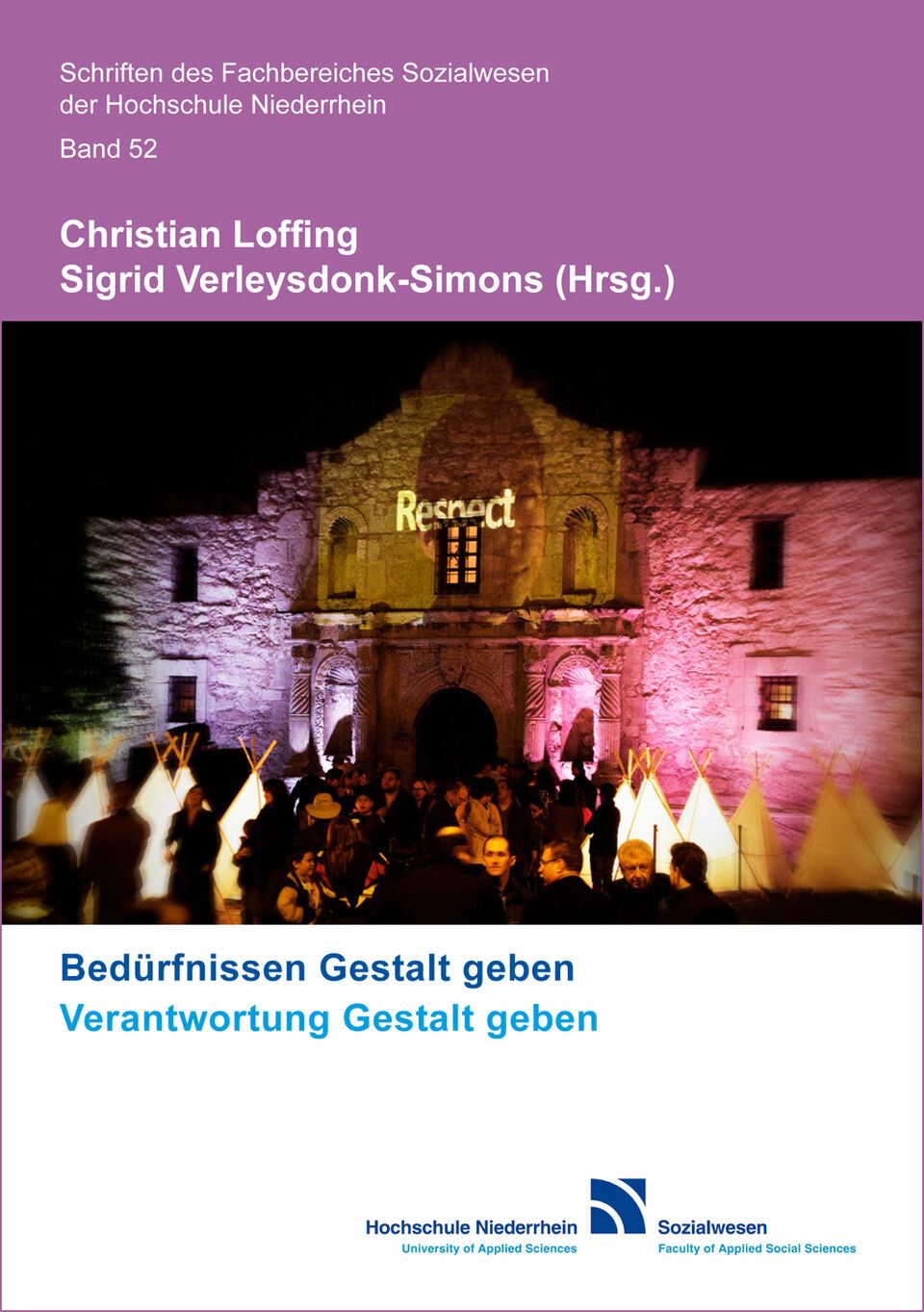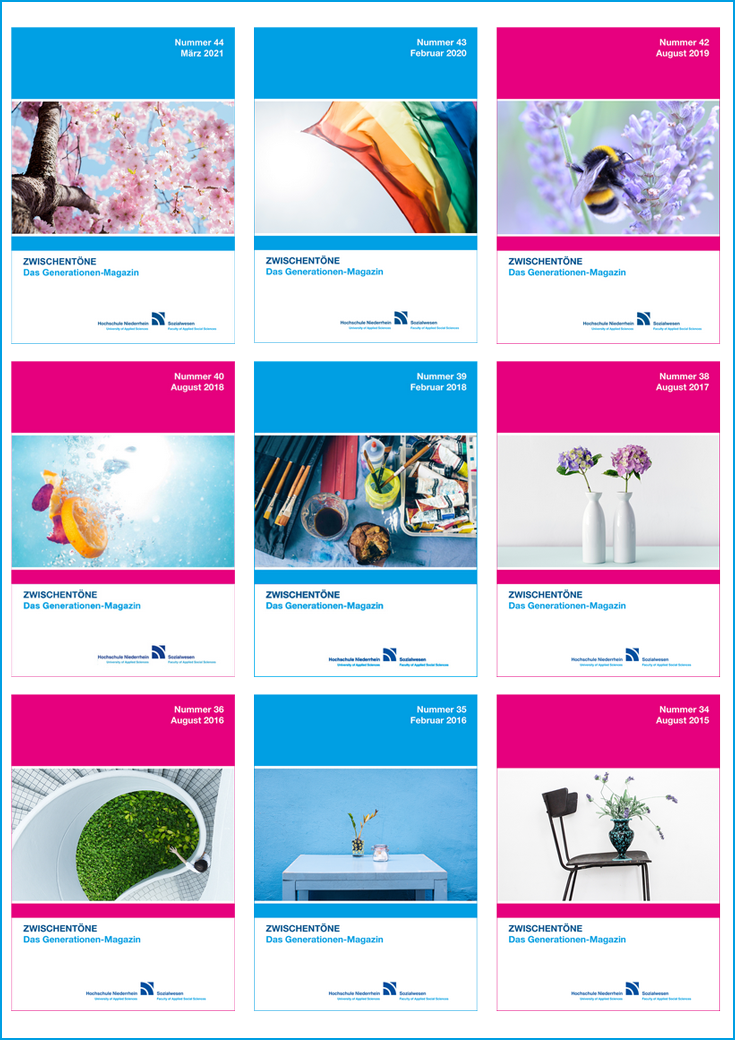Allein, aber nicht einsam!?
Interdisziplinäre Betrachtungen
Können Sie allein sein oder fühlen Sie sich gleich einsam, wenn Sie nicht unter Menschen sind? Und reicht es, wenn wir einsamen Menschen raten, sich mehr um soziale Kontakte zu kümmern?
Alleinsein, als freiwillige Entscheidung, um zur Ruhe zu kommen, Abstand zu gewinnen, Kraft zu tanken oder auch als selbst gewählte Unabhängigkeit, kann als unschätzbare Quelle angesehen werden, um den Anforderungen des Alltags zu begegnen.
Unfreiwillige Einsamkeit hingegen, die nicht nur vorübergehend ist, sondern dauerhaft, lässt die Menschen leiden, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Einsame Menschen schlafen schlechter, empfinden mehr Schmerzen, haben ein schwächeres Immunsystem und eine geringere Lebenserwartung.
In einer aktuellen Hochrechnung des Deutschen Alterssurveys auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland wurde geschätzt, dass im Jahr 2017 in der Gruppe der 40- bis 84-Jährigen mehr als 3,5 Millionen (9 %) von Einsamkeit betroffen waren.
Mit anderen verbunden zu sein und gute Beziehungen zu pflegen, ist für alle Menschen ein angeborenes Bedürfnis. Das Gefühl einsam zu sein, ist allerdings für viele Menschen eine leidvolle Erfahrung, die mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden ist.
Die Auseinandersetzung mit der Thematik ist hochaktuell. „Einsamkeit ist keine Privatsache, sondern auch die Folge prekärer Entwicklungen in unserer Gesellschaft“, schreibt die Rheinische Post im Mai 2019. Einsamkeit ist also kein rein individuelles, sondern ebenso ein gesellschaftliches Problem.
In der Vortragsreihe im Wintersemester 2019/2020 werden wir unterschiedliche Perspektiven auf das Spannungsfeld Alleinsein und Einsamkeit werfen und mit WissenschaftlerInnen und FachvertreterInnen in einen spannenden Diskurs treten.
Donnerstags, 14.15 – 15.45 Uhr
Start: 17.10.2019
► Download FLYER
► Download PLAKAT
Do, 17.10.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Das stille Thema Einsamkeit: Aktuelle Forschung und praktische Implikationen
Susanne Bücker, M.Sc.
Ruhr-Universität Bochum, Psychologin, Fakultät für Psychologie, Psychologische Methodenlehre
Einsamkeit ist zu einem großen Thema unserer Zeit geworden. Aber wie verbreitet ist Einsamkeit wirklich? Was wissen wir über die Ursachen und Folgen von Einsamkeit? Und was können Gesellschaft und Politik Einsamkeit entgegensetzen? Susanne Bücker, Psychologin an der Ruhr-Universität Bochum, forscht zu Einsamkeit und ihrer Entwicklung über die Lebensspanne. In einem einführenden Vortrag informiert sie über den aktuellen Forschungsstand und daraus resultierende praktische Implikationen.
Do, 24.10.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Einsamkeit – aus psychologischer Perspektive
Prof. Dr. Dieter Wälte
Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen, Klinische Psychologie und Persönlichkeitspsychologie
Aus psychologischer Perspektive umschreibt Einsamkeit hauptsächlich das Gefühl der Diskrepanz zwischen gewünschter und tatsächlicher sozialer Beziehung (in Bezug auf Vertrauen, gemeinsame Ziele, Bindung und Qualität der Beziehung). Dieses Gefühl erklärt auch die scheinbare Paradoxie, dass Menschen trotz vielfältiger sozialer Beziehungen sich dennoch einsam fühlen. In diesem Vortrag soll die Klärung von drei Fragen im Mittelpunkt stehen: 1. Wie werden Menschen einsam? 2. Ist Einsamkeit gefährlich? 3. Was führt psychologisch aus dem Gefühl der Einsamkeit wieder heraus?
Do, 31.10.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
„Ich glaube, das Schaf mag mich ...“ – Einsamkeit als Thema in der natur- und tiergestützten Beratung und Prozessbegleitung
Dr. Dipl.-Pädagogin Nicole Justen
Fachkraft für tiergestützte Interventionen, „Waldraum“ – Natur- und tiergestützte systemische Beratung und Prozessbegleitung
Einige Menschen, egal welchen Alters, geraten im Lauf ihres Lebens in persönliche Krisen, in denen sie sich zutiefst einsam und von anderen Menschen entfremdet fühlen. Die einen haben dabei das Vertrauen in andere Menschen verloren oder bereits negative Erfahrungen mit pädagogischen oder therapeutischen Unterstützungsleistungen gemacht. Die anderen suchen bewusst nach alternativen Wegen, um ihren Themen und Herausforderungen zu begegnen und neue Wege für sich zu finden. Tiergestützte Interventionen können in solchen Fällen hilfreich sein, um sich (wieder) einzulassen auf Beziehungen und Themen, und zwar über den Zugang zum Tier. „Ich glaube, das Schaf mag mich, darf ich jetzt öfter zu Dir kommen?“ (Aussage eines 9-jährigen Jungen mit zugeschriebenem ADHS und Therapieverweigerung).
Do, 07.11.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr /// S 304
Einsam? Zweisam? Gemeinsam! - Ideen und Praxisbeispiele zur Überwindung von Einsamkeit im Alter
Silke Leicht
Dipl.-Soziologin, Leiterin der Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) veranstaltete gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Ende 2018 den Wettbewerb „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ und suchte innovative und überzeugende Initiativen, die sich gegen soziale Isolation und für die gesellschaftliche Teilhabe älterer Menschen engagieren. Die rund 600 eingegangenen Projekte beeindruckten durch ihre große Vielfalt an Ideen. Der Vortrag stellt ausgewählte Praxisbeispiele zur Vermeidung und zur Verringerung von Einsamkeit im Alter dar und blickt über den Tellerrand: Was können wir von anderen Ländern lernen? Und was kann die Politik tun?
Do, 14.11.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Einsamkeit erkennen und überwinden
Thomas Hax-Schoppenhorst
Sachbuchautor und Pädagoge an der LVR-Klinik in Düren
Zunehmend wird in unserer Zeit, die von Egoismus und überbordender Individualisierung geprägt ist, das Phänomen der Vereinsamung und sozialen Isolation beobachtet. Besonders betroffen sind alte Menschen, aber auch Personen zwischen 20 und 30 Jahren klagen darüber. Die Ursachen hierfür sind vielfältig.
Der Referent gibt einen ausführlichen Einblick und zeigt Wege auf, wie einer Verschärfung entgegengewirkt werden kann bzw. sollte und wie Gesundheitsberufe einsame Menschen verstehen, unterstützen und integrieren können
Do, 21.11.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr /// S 304
Führt Einsamkeit zu psychischen Erkrankungen?
Priv.-Doz. Dr. Hanns Jürgen Kunert
Diplom-Psychologe, Median Klinik am Waldsee
Einsamkeit hat im Sprachgebrauch unterschiedliche Bedeutungen, sowohl negative (z.B. Zustand einer nicht erwünschten sozialen Isolation) als auch positive (z.B. als bewusste Strategie, sich für bestimmte Zwecke aus sozialen Bezügen zurückzuziehen). Betrachten wir nun Einsamkeit unter dem negativen Aspekt der sozialen Abgeschiedenheit oder Isolation, kann dies als eine i.d.R. chronische psychische Krisen- und Stresssituation betrachtet werden. Dieser Zustand wiederum steht mit neurobiologischen Reaktionen in Verbindung, die zur Entwicklung von Erkrankungen führen können. Im Extremfall kann dies beispielsweise unter Isolationshaftbedingungen zu schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen, wie z.B. psychotischen Zustandsbildern, Depression oder Suizid. In der Vorlesung wird auf diese Zusammenhänge näher eingegangen, wobei im Mittelpunkt steht, dass das Gehirn ein „soziales Organ“ ist und in seiner Funktionsweise von positiven und entwicklungsfördernden zwischenmenschlichen Kontakten abhängig ist, dies auch im höheren Lebensalter. Von daher hat die Überwindung von „Einsamkeit“ durchaus auch einen gesundheitsfördernden Charakter.
Do, 28.11.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Niemand ist im Alter ohne Grund allein
Erich Schützendorf
Dipl.-Pädagoge, Experte für Altersfragen und Altenpflege, Autor
Der Mensch wird im Alter nicht schwierig, aber ein schwieriger Mensch wird alt und bleibt schwierig. Dominante, rechthaberische, ausgrenzende, streitsüchtige, niederträchtige, missgünstige, selbstsüchtige, leidklagende, unzufriedene Menschen stehen im Alter schnell alleine da. Sie haben Freunde, Bekannte, Wohlgesonnene, ja Familienmitglieder über Jahre verprellt und fühlen sich allein gelassen, wenn sie im Alter auf Hilfe angewiesen sind. Aber selbst dann weisen sie gutwillige Besucher und Pflegekräfte ab oder bestehen darauf, dass nach ihrer Pfeife getanzt wird.
Der Referent stellt die Frage, wie man anständig mit diesen Menschen, die schwer auszuhalten sind, umgehen kann, und ob man sie allein lassen darf, wenn ihre Grundbedürfnisse gesichert sind.
Do, 05.12.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr /// S 304
Das Alleinleben im Alter – Zahlen und Fakten, Lebensverläufe und Gestaltungspotenziale
Arthur Drewniok, M.Sc.
Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen, Pflegewissenschaftler
Das Alleinleben im Alter ist im gesellschaftlichen Diskurs deutlich negativ belegt. Es wird mit einem Zustand assoziiert, der unbedingt verhindert werden muss! „Der Mensch ist ein soziales Wesen, das Alleinsein widerspricht seiner Natur“ – so die gängige Argumentation. Im Rahmen des Vortrages möchte ich Ihnen unterschiedliche Zugänge zu dem Phänomen Alleinleben (im Alter) vorstellen. Zunächst wird es darum gehen, Alleinleben zu definieren. Die Statistik unterscheidet hier z.B. zwischen Alleinlebenden und Alleinstehenden, zwischen ledigen, verwitweten und geschiedenen Personen, etc. Im zweiten Schritt werden wir einen Blick auf die Wege in das Alleinleben richten und uns mit den Wirkungen des Alleinseins für das Leben der Menschen (im Alter) beschäftigen. Gibt es den/die typischen Alleinlebenden? Welche Eigenschaften verbinden wir eigentlich mit Menschen, die allein leben und wie sehen sich eigentlich die Alleinlebenden selbst? Sind sie sehr einsam und leiden sie darunter? Im letzten Teil möchte ich mit Ihnen über Gestaltungspotenziale für ein bedürfnisorientiertes, selbstbestimmtes und würdevolles Alleinleben im Alter (trotz z.B. Pflegebedarf und Demenz) diskutieren.
Do, 12.12.2019 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Alleinsein als Ressource
Prof. Dr. Michael Borg Laufs
Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen, Theorie und Praxis psychosozialer Arbeit
Das Alleinsein hat einen schlechten Ruf, ist doch Bindung immerhin ein psychisches Grundbedürfnis. Aber wollen wir wirklich immer in Kontakt sein, immer unter Menschen? Psychologische Untersuchungen zeigen, dass Alleinsein auch eine Ressource ist, aus der wir Kraft, Ruhe und Kreativität schöpfen können
Do, 09.01.2020 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Ist die Welt nur mein Traum? Wie allein ich in der Welt tatsächlich bin
Benedikt Eisermann, M.A.
Hochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen, Philosoph
Könnte es nicht sein, dass in der Welt nur das eigene Ich existiert? Mein Ich und die Welt wären dann identisch. In einer solchen Welt dürfte ich mich mit Recht sehr einsam fühlen. Und tatsächlich ist es unmöglich zu sagen, ob es eine Welt außerhalb des eigenen Bewusstseins gibt. Wie kann ich dann aber wissen, dass ich nicht ganz allein auf der Welt bin? Was kann ich überhaupt über den anderen – und auch über mich selbst – wissen? Wie nah kann ich einem anderen Menschen überhaupt kommen? Im Vortrag sollen nicht nur Antworten auf diese Fragen gegeben werden, sondern darüber hinaus aufgezeigt werden, wie man die Antworten für einen gelingenden Umgang mit anderen Menschen nutzen kann – und damit über mindestens ein Mittel gegen die Einsamkeit verfügt
Do, 16.01.2020 // 14.15 - 15.45 Uhr // S 304
Der soziale Sinn der Einsamkeit: Ergebnisse einer kulturvergleichenden Studie der Biographien vereinsamter Menschen
Dr. rer. pol. Janosch Schobin
Soziologe, Universität Kassel, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Leitung BMBF-Nachwuchsgruppe DeCarbFriends
Vereinsamung, verstanden als das Zugleich eines langanhaltenden Kontaktverlusts zu relevanten Nahpersonen und intensiven Einsamkeitsempfindungen, wird mehr und mehr zu einem politischen Thema. Sie wird zu einer Art neuen „Volkskrankheit“ stilisiert, die es zu bekämpfen gilt. Aber über die soziale Lage und die Lebensumstände vereinsamter Menschen ist bei Lichte besehen nur Grobes bekannt. Es stellen sich daher einfache Fragen: Wie leben sie, wie deuten sie ihre Vereinsamung und wie gewinnen sie ihrer Existenz Sinn ab? Der kulturelle Vergleich der Biographien Vereinsamter zeigt dabei an, dass es erhebliche Unterschiede in der Weise gibt, wie Vereinsamung interpretiert und mit sozialer Bedeutung gefüllt wird.